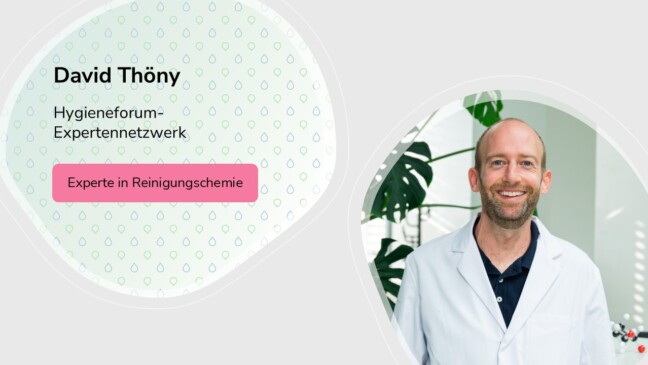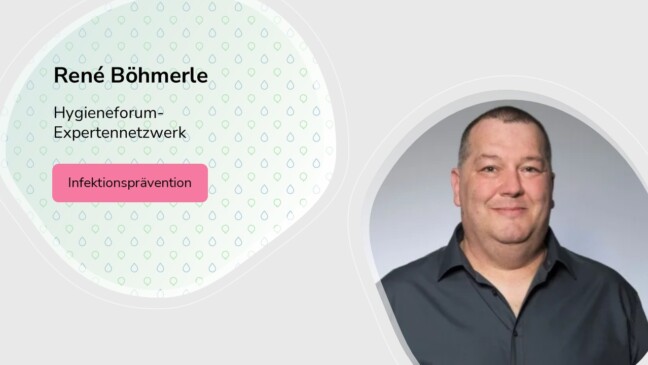17.09.25
Im Gespräch mit Thomas Leiblein: Warum Wasserhygiene mehr Aufmerksamkeit verdient
Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins – und doch unterschätzen viele die Risiken, die von mangelnder Wasserhygiene ausgehen. Thomas Leiblein, Experte für Wasser-, Luft- und Oberflächenhygiene, und Mitglied im Expertennetzwerk des Hygieneforum.ch erklärt, warum Legionellen-Prävention heute wichtiger denn je ist und wie Betriebe ihre Resilienz durch gezielte Audits stärken können.
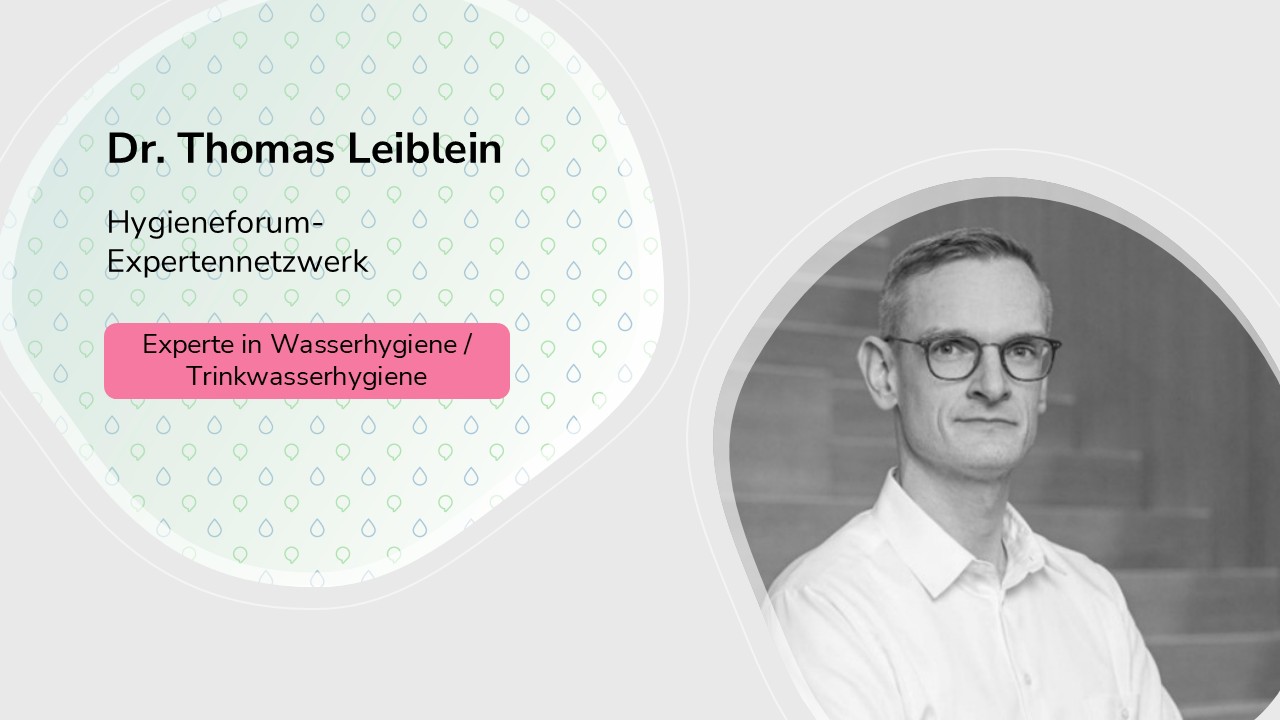
Thomas Leiblein ist promovierter Life-Science-Spezialist und Dipl.-Ing. (FH) mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Hygiene und Infektionsprävention. Nach Stationen in Forschung, Lehre und Spitalhygiene gründete er 2025 gemeinsam mit Partnern die ewah AG – experts in water, air and hygiene. Als Projektleiter und Auditor berät er Unternehmen bei der Umsetzung von Wassersicherheitskonzepten, führt Hygiene-Audits durch und gilt als ausgewiesener Fachmann für Trinkwasserhygiene und Legionellen-Prävention.
Herr Leiblein, können Sie uns kurz Ihren beruflichen Werdegang und Ihre Spezialisierung im Bereich Hygiene und Infektionsprävention vorstellen?
Inzwischen darf ich auf mehr als 20 Jahre Tätigkeit im Fachbereich Hygiene zurückblicken. Engagements umfassten hierbei, unter anderem, die Erarbeitung und Implementierung von Hygienekonzepten, spezifische Fragestellungen im Prozess- und Risikomanagement, das Hygiene-Monitoring / Auditierung, die Aus- und Weiterbildung. Mein Interesse für die Hygiene erwuchs während meiner Zeit als Zivildienstleistender, als ich auf der inneren Station eines Krankenhauses im Schichtbetrieb der Pflege mitarbeitete. Dies prägte mich für die Berufswahl und stellte die Weichen für meine fachliche Ausbildung. Zusammenhänge zwischen belebter und unbelebter Umgebung, das nicht Sichtbare (Mikrobiologie, Chemie, Physik), das Einfluss auf die menschliche Gesundheit hat, fanden fortan im praktisch ausgerichteten Fachhochschulstudium, mit Abschluss zum Dipl.-Ing. (FH) für Ernährungs- und Hygienetechnik, in einer entsprechenden Ausbildungsstätte ihre Anerkennung. Nach einem Objektmandat in der Gebäudereinigung bei der Dorfner-Gruppe in München, wechselte ich im Jahr 2008 in die Schweiz an das Institut für Facility Management der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), wo ich als Assistent an der Seite von Thomas Hofmann, einem leidenschaftlichen Chemiker, Naturwissenschaftler, Arbeitshygieniker und Dekontaminations-Experten mit breiter Management-Erfahrung, für Spezialfragestellungen aus der Industrie, Projektvorhaben, F&E, aber insbesondere im Bereich der Aus- und Weiterbildung tätig war.
Nach fast 10 Jahren am Institut kam der Zeitpunkt für einen Wechsel. Ich engagierte mich in der Folge direkt im Gesundheitswesen, wobei sich der Schwerpunkt vom Facility Management hin zu einer Fach- und Führungsaufgabe im Bereich der Spitalhygiene der Schweizer Klinikgruppe Hirslanden verlagerte, mit einer starken Gewichtung auf das Qualitäts- und Risikomanagement. Prägend dort war die Zusammenarbeit und die fachliche Führung medizinischer Themen unter Prof. Dr. Rami Sommerstein, einem exzellenten Infektiologen und Forscher. Nach drei Jahren dort, und drei weiteren Jahren in einer auf die Trinkwasserhygiene spezialisierten Fachgruppe bei der Vadea AG, einem Planungs- und Ingenieurbüro, ergab sich zu Beginn des Jahres 2025 die Möglichkeit, als Teilhaber mit Arbeitskollegen die ewah AG zu gründen. Dort arbeite ich seither als Projektleiter. Als interdisziplinäres, fachlich breit aufgestelltes, unabhängiges Beratungsunternehmen bieten wir als ‘experts in water, air and hygiene’ Dienstleistungen im Bereich der Bauherrenberatung, Wasser-, Luft-, und Oberflächenhygiene an. Unsere Expertise im Bereich Trinkwasserhygiene ist durch unsere fachliche Besetzung schweizweit einzigartig.
Was hat Sie motiviert, sich auf Wasserhygiene und Legionellen-Prävention zu fokussieren?
Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Ohne Wasser ist der Mensch nicht lange und, rein vom biologischen Aufbau her gesehen, nicht viel. Wer seine Gesundheit unterstützen möchte, sollte sein Leben auf unterschiedlichen Ebenen gesund gestalten. Doch es gibt Einflussgrössen, so auch auf das Trinkwasser, die zu Infektionen und Erkrankungen führen können. In meiner Doktorarbeit befasste ich mich mit der Trinkwasserhygiene in Gebäuden des Gesundheitswesens verschiedener Länder. Während der Forschungsarbeiten zum Thema stellte ich immer wieder fest, dass einerseits die Management-Strukturen der Betriebe, andererseits die Organisation und der Zugang zu Fachwissen und die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen (z. B. Umsetzung regelmässiger, periodischer Unterhaltsarbeiten) entscheidende Faktoren dafür sind, ob und inwieweit (sich verändernde) Anforderungen an die verantwortlichen Bereiche der Trinkwasserinstallationen Berücksichtigung finden und erfüllt werden. Als Forschungstitel definierte ich daher genau diese Betrachtungsebenen: «Wassersicherheitsmanagement, Legionellen-Prävention und Risikomanagement in Krankenhäusern: Ein Rahmen für die Immobilien- und Anlagenverwaltung in England». Durch meine eigene Fach- und Führungsposition in einem Schweizer Gesundheitsbetrieb war ich buchstäblich an der «Quelle» der Geschehnisse und konnte 1:1 die Herausforderungen notwendiger Management- und Change-Prozesse im Denken und Handeln, hin zu mehr Prozesssicherheit im Bereich der verpflichtenden Selbstkontrolle, durchlaufen.
Was versteht man unter Wasserhygiene und welche Themen deckt die Wasserhygiene ab?
Wasserhygiene ist ein weites Feld, genau wie der Weg des Wassers von der Quelle bis zum Endverbraucher. In Betrieben, als Bereitsteller unterschiedlicher Wasserqualitäten an die Nutzenden, kann Wasser unterschiedlichen Qualitätsanforderungen unterliegen. Hier ist zunächst auch erforderlich zu wissen, für welchen Zweck / Prozess / Nutzen Wasser benötigt wird. Durch technische Aufbereitungsschritte und entsprechenden Anlagen können die an das Wasser gestellten Kriterien derart beeinflusst werden, dass chemische, mikrobiologische und physikalische Parameter auf Zielwerte bzw. Toleranzbereiche eingestellt werden können. Jedoch sollte man sich immer über zwei Dinge bewusst sein:
- Trinkwasser ist kein steriles Wasser
- Nimmt man Einfluss auf die Wasserqualität, so verändern sich zwangsläufig chemische, mikrobiologische und physikalische Eigenschaften des Wassers.
Als Folge von derartigen Veränderungen, ob gezielt herbeigeführt, oder durch fehlerhafte Installationen hervorgerufen, können Qualitätseinbussen und sogar (technische, auf Anlagen oder Produkte bezogene) Risiken bis hin zur Gesundheitsgefährdungen entstehen.
Ziel der Wasserhygiene ist es daher, die Qualität des Wassers in der multifaktoriellen Gesamtbetrachtung so weit zu kontrollieren und zu steuern, dass keine Gesundheitsgefährdung entsteht und dass Prozesse bestimmungsgemäss (wie ausgelegt und geplant) betrieben werden können.
Welche Bedeutung hat die Wasserhygiene und insbesondere die Legionellen-Prävention heutzutage?
Die Wasserhygiene nimmt an Bedeutung zu. Das stellen wir in vielen Bereichen fest. Insbesondere auch die Trinkwasserhygiene. Einerseits sind in den vergangenen Jahren, und aktuell auch, die Vorschriften bezüglich der Hygiene-Anforderungen an das Lebensmittel Trinkwasser gestiegen – ich hebe hier z. B. die breite Anerkennung von Hygienethemen und zugehöriger Normen und Richtlinien in der Planungs- und Baubranche, oder die angepassten BAG / BLV Module «Empfehlungen zu Legionellen und Legionellose» hervor – andererseits treten immer mehr Fragestellungen im Zusammenhang mit Wasserhygiene auf, was auch als Folge des Fachkräftemangels, veränderter Lieferketten, steigender Kosten für qualitativ nachhaltig ausgelegte Bauwerke und sich verändernden klimatischen Bedingungen zu deuten ist. Legionellen wachsen dort, wo sie gute Bedingungen antreffen. Dies ist bei Temperaturbereichen zwischen 25 °C und 45 °C (auch etwas darüber) und entsprechendem Nährstoffangebot der Fall. Aber es kommen auch noch weitere Faktoren zum Tragen, so dass verbreitete «Alltage-Strategien» zur Eindämmung von befallenen Trinkwasserinstallationen teilweise nur bedingt zum Erfolg führen. Hier müsste sich der Blick der Betriebe stärker zu einem präventiven Denkansatz mit Handlungsfolge für eine langfristig erfolgreiche (souveräne) Strategie wandeln. Teilweise besteht bei Bauherren, Architekten, Eigentümern, Vermietern und Mietern nach wie vor Unwissenheit oder Unsicherheit über Hygienerisiken und Pflichten zur Selbstkontrolle oder gar eine erfolgsvernichtende Haltung aufgrund des ablehnenden Denkmusters «das war doch früher auch kein Problem».
Sie bieten nebst der Projektleitung auch Hygiene-Audits an. Welche Bedeutung haben diese Hygiene-Audits und wie laufen diese ab?
Unsere Audits decken den Bereich der Umwelthygiene ab. Dabei unterscheiden wir zwischen drei Modulen, nämlich der Trinkwasserhygiene, der Lufthygiene und der Betriebshygiene, die z. B. die klassische Oberflächenhygiene einschliesst. Bei unseren Audits prüfen wir im Auftragsverhältnis bestehende Hygienekonzepte auf ihre Robustheit und decken Optimierungspotenziale auf. Ziel ist, dass Verantwortliche in den Betrieben ihre Hygienekonzepte am Stand der Technik (neu) ausrichten. Die Audits verlaufen mehrstufig und beginnen mit einem Vorgespräch und vorgelagertem Dokumentenstudium (Planunterlagen, Prozessdokumente, Prüfberichte, etc.). Es folgen eine kurze Interviewsequenz und eine Begehung. Danach wird ein Bericht erstellt und mit den Verantwortlichen und dem Management besprochen, um die Ausgangslage transparent darzulegen (Fit-Gap-Analyse / Ausweisen von Nicht-Konformitäten / Massnahmendiskussion). Durch diese externen Audits sind Betriebe befähigt, ihre Resilienz zu stärken. Sie schärfen bereits während des Audits ihre eigenen Kompetenzen.

Dr. Thomas Leiblein
Ausbildung: PhD, MSc ZFH in Life Sciences, Dipl.-Ing. (FH), Schwerpunkt: Hygiene
Derzeit: Projektleiter, Auditor bei der ewah AG – experts in water, air and hygiene
Expertennetzwerk: hygieneforum.ch/hygiene-experten/
Bei welchen Arten von Gebäuden ist die Wasserhygiene und damit zusammenhängend ein Wassersicherheitskonzept besonders wichtig?
Grundsätzlich ist Wasserhygiene ein Thema für jeden Typ von Gebäude. In der SVGW Richtlinie W3/E4, die die Selbstkontrolle in Gebäude-Trinkwasserinstallationen nach dem Stand der Technik beschreibt, unterscheidet man in Tabelle 1 nach so genannten Gebäudekategorien. Es ist nicht verwunderlich, dass insbesondere Betriebe im Gesundheitswesen, wie Spitäler und Alters- und Pflegezentren, periodisch häufigere Kontrollintervalle aufweisen als andere Gebäudekategorien, wie zum Beispiel Hotels / Beherbergungsbetriebe, Schul- und Sportanlagen und generell öffentlich zugängliche Bereiche mit Duschanlagen. Denn dort halten sich vermehrt vulnerable und/oder immungeschwächte Personengruppen auf, die besonders anfällig für Infektionen durch wasserassoziierte Krankheitserreger sind.
Allen Gebäudetypen gemeinsam ist eine vorgesehene, bestimmungsgemässe Nutzung. Eine Bestandesaufnahme der potenziell vorhandenen Risiken der Trinkwasserinstallation, sowie routinemässig anfallende Betriebs-, Temperatur- und Mikrobiologie- (z. B. Legionellen) Kontrollen, einhergehend mit der Instandhaltung der Installationen und Apparate, stellen die Grundzüge der Selbstkontrolle dar. Auch im Verhältnis Eigentümer – Mieter gibt es beidseitige Verpflichtungen zu beachten. Ein zugrunde gelegtes, verbindliches Selbstkontrollkonzept ist daher unerlässlich.
Was sind die grössten Herausforderungen bei der Umsetzung von Wassersicherheitskonzepten?
Generell ist hier als grösste Herausforderung das Bewusstwerden um, und die Bewusstseinsschärfung der Stakeholder (z. B. während eines Planungs- und Bauprojekts) und der Betriebsverantwortlichen für etwaige Risiken hervorzuheben. Daneben spielen konkrete, betrieblich zumutbare und konsequente Handlungen, die den Erfordernissen einer (problematischen) Ausgangslage folgen, eine wichtige Rolle. Niemand befasst sich gerne mit potenziellen und vielleicht sogar kostspieligen Problemfeldern. Es bedarf daher einer adressatengerechten, unabhängigen Kommunikation und beruflich-professionalisierter Empathie. Sie ist unerlässlich. Wir verstehen uns, im Rahmen unserer Dienstleistungen, als Vermittler oder Botschafter und sind es gewohnt, auf unterschiedlichen Hierarchieebenen und mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen zu kommunizieren. Dennoch: In der Pflicht bleiben die Betriebe bzw. die Verantwortlichen und Entscheidungsträger selbst.
Können Sie ein Beispiel aus Ihrer Praxis nennen, wo ein Hygiene-Audit bis dahin unbekannte Probleme, bzw. Gefahren aufdeckte?
Ich erinnere mich an ein frühes Audit in einem Ärztezentrum für Reproduktionsmedizin. Nach einem Vorgespräch wurde der Zweck des Beizugs eines externen Experten klar. Die Auditinhalte wurden entsprechend verschiedener Betrachtungsebenen kategorisiert. Vorhandene Dokumente wurden beigezogen, um die bestehenden Prozesse kennenzulernen. Das Zentrum hatte zwar im Bereich der Praxishygiene und Aufbereitung weit entwickelte und konzeptionell gut durchdachte Prozesse etabliert, dennoch wurden Probleme aufgedeckt. Die Räumlichkeiten waren angemietet. Im Auditverlauf wurden mikrobiologische Höchstwertüberschreitungen der Trinkwasserinstallation festgestellt, die sogar das Kaltwassersystem betrafen und bis an den an das Kaltwassernetz installierten Trinkwasserspender weitergereicht wurden. Neben der hygienisch problematischen Nutzung der Personaldusche eine schwerwiegende Abweichung vom Soll-Zustand. Die «Systemgrenze» und das Verhältnis Eigentümer – Mieter musste im Bereich der gebäudeinternen Trinkwasserversorgung geklärt und die Rollenverteilung der Selbstkontrolle für die erforderliche Massnahmenplanung und Kommunikation der unzureichenden Wasserqualität definiert werden. Vergleichbare Lücken in Hygienekonzepten und das Ausbleiben erforderlicher Massnahmen lassen sich auch bei Versorgungssituationen z. B. von Zahnarztpraxen oder eingemieteter Belegarztpraxen in Spitalbauten erkennen.
Welche Trends sehen Sie in den nächsten Jahren im Bereich Wasserhygiene und Infektionsprävention?
Von Trends möchte ich hier nicht sprechen, denn Trends haben in meinen Augen eine kurzgefasste Erfolgszeit, eine geringe Verbindlichkeit und tragen selten langfristig zu verantwortungsvollem Handeln bei. Meist werden sie entweder durch einseitig befürworteten Erkenntnisgewinn oder durch radikales oder rücksichtsloses Erfolgs- oder Gewinnstreben aus dem Boden gestampft. Zulasten derer, die hierfür anfällig sind. Ich sehe aktuelle und kommende Herausforderungen und versuche, zusammen mit Gleichgesinnten, darauf vorzubereiten und Lösungswege zu finden. Grosse Themen generell werden die langfristige Verfügbarkeit der gesunden Ressource Trinkwasser und der Zugang hierzu sein – zugegeben sehr globale Themen, wie sie von der WHO erkannt sind. Aber auch das Abwassermanagement spielt eine wichtige Rolle. Ebenso die Herausforderungen der Gesellschaft mit zunehmenden Antibiotikaresistenzen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Strategien des Bundes in ihrem One Health-Aktionsplan StAR 2024 – 2027 und auf die strukturellen Mindestanforderungen für die Prävention und Bekämpfung von healthcare-assoziierten Infektionen (HAI) in Schweizer Akutspitälern.
Was treibt Sie persönlich an, in diesem Bereich aktiv zu bleiben?
Obwohl auch mich das Thema der erneuerbaren Energien mehr denn je betrifft, so gibt es die geflügelten Worte des Mineralölkonzerns Esso aus den siebziger Jahren, die da lauten «Es gibt viel zu tun – packen wir’s an!». Ich fühle mich seit meiner Berufswahl dem Thema Hygiene, also der Gesundheit, verpflichtet. Anders als das «lebendige Wasser», das nur in der Bibel beschrieben wird und meiner Seele guttut, gibt mir das Tätigkeitsfeld eine berufsbezogene Sinnstiftung.
Im Hygieneforum veröffentlichte Beiträge von Thomas Leiblein