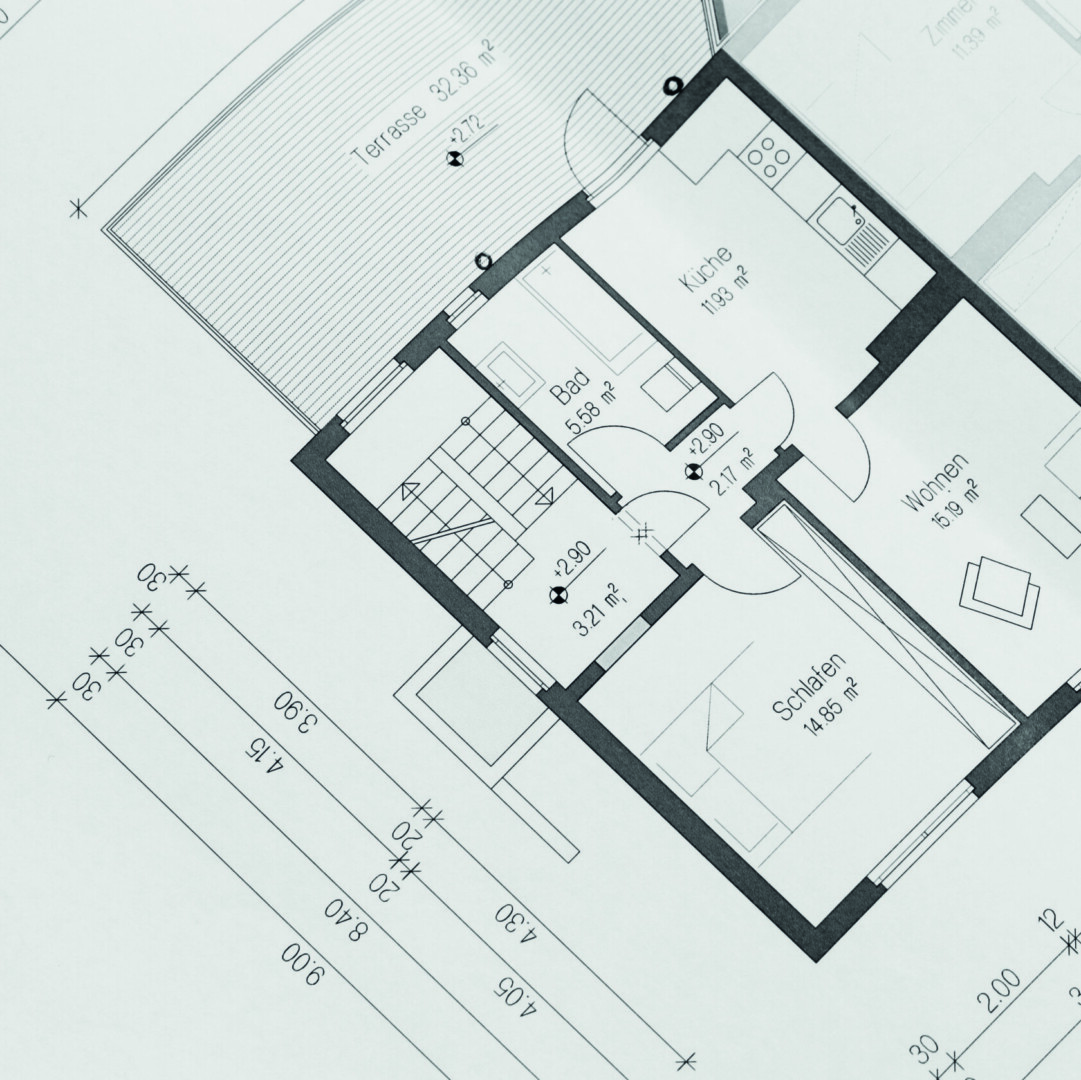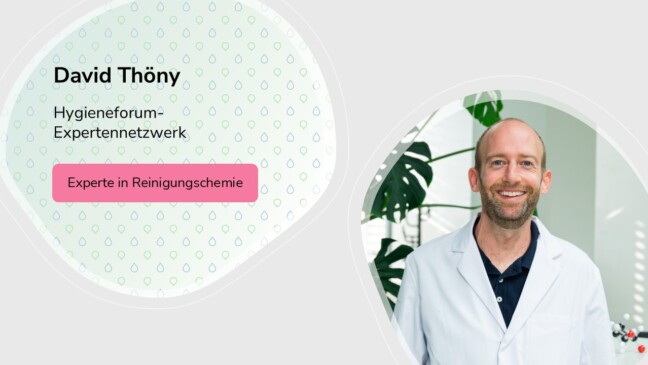
28.10.25
Vom Rettungsdienst zur Spitalhygiene: René Böhmerle über Herausforderungen und Zukunft der Infektionsprävention
René Böhmerle, Mitglied im Expertennetzwerk des Hygieneforum.ch, hat eine beeindruckende Laufbahn vom Rettungsdienst über Intensivpflege bis hin zur Spitalhygiene durchlaufen. Heute berät er Gesundheitseinrichtungen bei der Umsetzung wirksamer Hygienekonzepte und warnt vor den unterschätzten Risiken mangelnder Compliance und multiresistenter Erreger. Im Gespräch erklärt er, warum Prävention unverzichtbar ist, welche Herausforderungen Spitäler aktuell bewältigen müssen und wie neue Technologien die Infektionsprävention verändern werden.
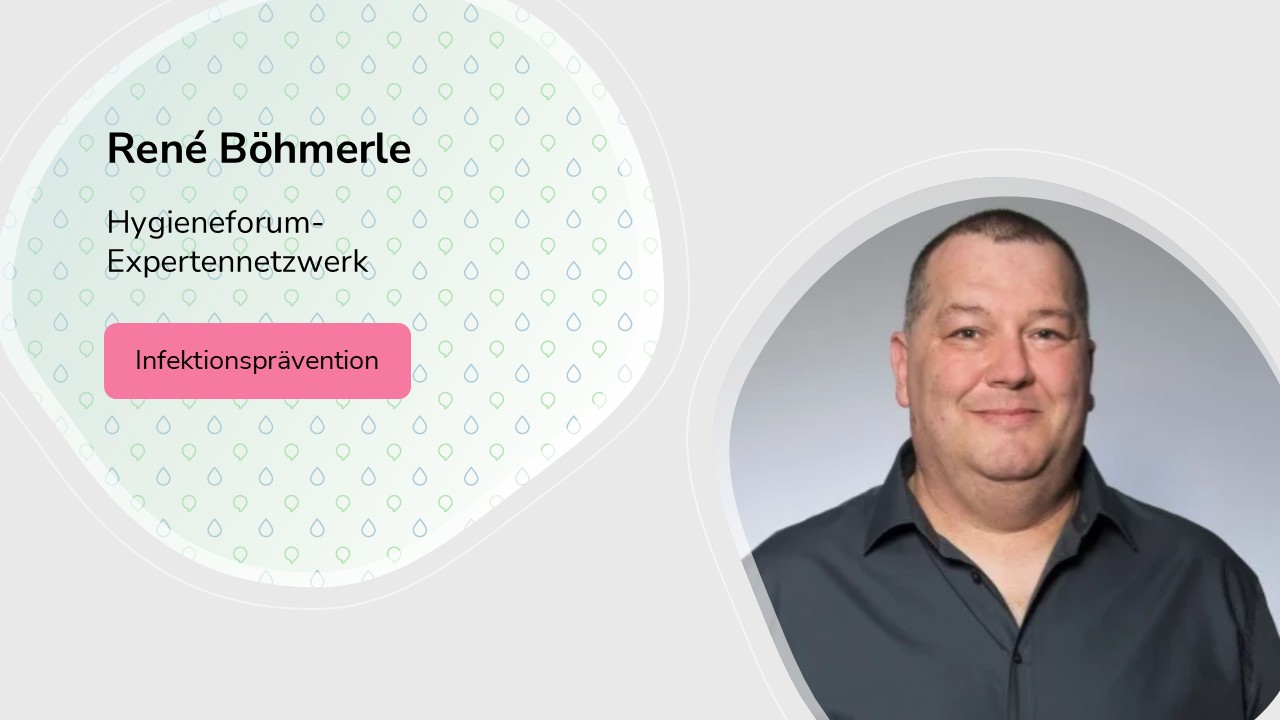
René Böhmerle ist Fachexperte für Infektionsprävention im Gesundheitswesen (HFP) mit eidgenössischem Diplom und verfügt über langjährige Erfahrung im Spitalbereich, insbesondere in Intensivmedizin/IMC und Anästhesie. Nach seiner Managementausbildung und Übernahme von Leitungsfunktionen im Jahr 2007 spezialisierte er sich 2015 auf Infektionsprävention. Heute begleitet René Böhmerle durch die B&B Hygieneberatung GmbH Gesundheitseinrichtungen bei der Entwicklung und Umsetzung praxisnaher Hygienekonzepte, führt Audits durch und unterstützt Teams dabei, Infektionsprävention nachhaltig in den klinischen Alltag zu integrieren.
Herr Böhmerle, Sie haben eine Laufbahn vom klinischen Alltag bis hin zur Beratung durchlaufen. Können Sie uns Ihren Werdegang kurz schildern und was Sie motiviert hat, sich auf Hygiene und Infektionsprävention zu spezialisieren?
Schon früh wusste ich, dass ich einen Beruf machen möchte, bei dem ich anderen helfen kann. Bereits mit 14 Jahren engagierte ich mich bei der freiwilligen Feuerwehr in meinem Heimatort.
Meine berufliche Karriere begann 1987, wo ich mich für acht Jahre bei der Bundeswehr in Deutschland verpflichtet habe. Dort absolvierte ich die Ausbildung zum Rettungssanitäter und arbeitete im Bundeswehrkrankenhaus Ulm in der Notaufnahme mit Einsätzen auf dem Rettungshubschrauber SAR Ulm 75. Nach mehreren Jahren im Rettungsdienst beschloss ich 1998 die Ausbildung zum Pflegefachmann zu durchlaufen. Schnell merkte ich, dass die normale Krankenpflege für mich zu wenig Abwechslung bot und so absolvierte ich die Fachweiterbildung zum Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin. Es bot sich dann die Gelegenheit zu einer Leitungstätigkeit einer Intensivstation weshalb ich noch das Managementstudium Fachwirt für Organisation und Führung im Sozialwesen durchlief.
2007 bekam ich die Chance im Kantonsspital Baden als Stationsleiter eine Intermediate-Care Station aufzubauen. Als dies erfolgreich umgesetzt war, fand ich den Weg in die Hygiene. Meine Frau arbeitete bereits in diesem Bereich; so konnte ich erste Erfahrungen sammeln und mein Interesse für das Thema Infektionsprävention entwickeln. Aus dieser Motivation heraus absolvierte ich schliesslich die höhere Fachprüfung zum Fachexperten für Infektionsprävention im Gesundheitswesen. Das Thema Hygiene begleitete mich schon länger und letztendlich liess ich mich von meiner Frau mit der Leidenschaft für das Thema Infektionsprävention anstecken, wobei eine Ansteckung in diesem Zusammenhang als positiv zu werten gilt!
Aktuelle Herausforderungen
Wo sehen Sie aktuell die grössten Herausforderungen für Spitäler und Pflegeeinrichtungen im Bereich Infektionsprävention?
Aus meiner Sicht stellt der Fachkräftemangel und der hohe Personalwechsel, insbesondere bei Pflegepersonal und Hygienefachkräften, die aktuell grösste Herausforderung dar. Dies führt zu einer Belastung der bestehenden Teams und erschwert das Umsetzen von Massnahmen welche für hohe Qualitäts- und Hygienestandards notwendig sind. Eine weitere Rolle spielt erfahrungsgemäss auch die sprachliche Barriere bei Mitarbeitenden welche nicht Deutsch als Muttersprache haben. Diese sind meist sehr motiviert, benötigen jedoch aufgrund der Sprachproblematik mehr Zeit bei der Einarbeitung und Anleitung. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die zunehmende Komplexität des Patientenklientels durch Multimorbidität und immer frühere Verlegungen in Anschlussinstitutionen wie Rehakliniken, Pflegeheime oder Spitexversorgung dar. Im Zusammenspiel mit den bereits erwähnten Faktoren führt dies zu enorm schwierigen Bedingungen für die Umsetzung von Präventionsmassnahmen. Die angespannte finanzielle Situation und der dadurch entstehende Kostendruck in vielen Einrichtungen verschärft das Spannungsverhältnis zwischen Kosteneffizienz und benötigten Ressourcen für Hygienemassnahmen. Dabei wird leider oft nur sehr kurzsichtig gerechnet und nicht bedacht, dass Prävention zwar Geld kostet, langfristig jedoch enorme Kosten einspart. Eine Diskussion des ethischen Aspekts dieses Themas würde hier den Rahmen sprengen…
Welche Faktoren erschweren aus Ihrer Sicht die Umsetzung wirksamer Hygienemassnahmen?
Als erstes würde ich hier die mangelnde Compliance nennen. Trotz klarer Richtlinien ist die Einhaltung standardisierter Massnahmen z.B. Händehygiene und Isolationsmassnahmen in Stresssituationen oder bei hoher Arbeitsbelastung oft nicht gewährleistet.
Eine ständige Herausforderung stellen die Schnittstellen zwischen den einzelnen Bereichen aber auch Institutionen dar. Eine unzureichende interprofessionelle Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Pflege, Therapien, Ärzteschaft, Hauswirtschaft, Reinigung und Logistik führt erfahrungsgemäss häufig zu Fehlern. Darüber hinaus werden die Auswirkungen einer fehlenden Priorisierung der Hygiene durch das Management und die dadurch ausbleibende Übernahme einer Vorbildfunktion als Faktor oft unterschätzt.
Multiresistente Erreger
Wie schätzen Sie die aktuelle Situation im Umgang mit multiresistenten Erregern ein?
Die Situation ist ernst. Die Strategien NOSO und StAR des Bundes sind sehr gute Ansätze, jedoch noch nicht in der breiten Praxis angekommen. So geht wertvolle Zeit verloren und man ist der Entwicklung weiterer Resistenzen immer einen Schritt hinterher. Durch die Globalisierung wird die Situation zusätzlich erschwert. Das Bewusstsein für den Ernst der Lage ist vorhanden. Die Wurzel des Problems ist aber multifaktoriell und global, weshalb es schwierig ist, die Massnahmen aller an der Lösung beteiligten Akteure zeitnah und effektiv zu koordinieren.
Sind die Einrichtungen in der Schweiz aus Ihrer Sicht ausreichend vorbereitet?
Das ist ganz unterschiedlich. Unispitäler und grössere Kliniken sind in der Regel gut vorbereitet, verfügen über gut ausgebildete Spitalhygieneteams, Isoliermöglichkeiten und Laborkapazitäten für schnelles Screening. Kleinere Spitäler sind oft an die grossen Kliniken angeschlossen und können von deren Infrastruktur und Expertise profitieren. Langzeitpflegeeinrichtungen haben es dahingegen sehr viel schwerer. Für diesen Bereich gibt es relativ wenig wissenschaftliche Evidenz und das Bildungsangebot ist nicht auf dieses Setting angepasst. Das BAG hat dieses Problem erkannt und deshalb die Strategie NOSO auch auf den Bereich Pflegeheime ausgeweitet. Für den ambulanten Bereich allerdings besteht noch grosser Handlungsbedarf. Aus meiner Sicht muss die Individualität der einzelnen Bereiche Akut, Langzeit und Ambulant in der Umsetzung von Massnahmen mehr berücksichtigt werden.
Technologische Entwicklungen
Welche Rolle spielen neue Technologien wie digitale Monitoring-Systeme oder Desinfektionsroboter in der Infektionsprävention?
Neue Technologien spielen eine zunehmend wichtige Rolle zur Unterstützung der Infektionsprävention und Kontrolle, dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Die Defizite der einzelnen Systeme müssen sorgfältig beurteilt werden. Z.B. die Strahlenschatten bei der UVC-Desinfektion oder mögliche Fehlerfassungen bei der Händehygiene, wenn z.B. Händedesinfektionsmittel fälschlicherweise für die Flächendesinfektion aus einem Spender entnommen wird. Die definitive Kontrolle muss deshalb beim Menschen bleiben. Momentan sind solche Technologien meist mit hohen Kosten verbunden, weshalb sie nur von grossen Spitälern eingesetzt werden können. Aber prinzipiell ist alles gut, was eine Arbeitserleichterung bringt und/oder das Bewusstsein für Hygienemassnahmen wieder auffrischt.
Halten Sie diese Lösungen für unverzichtbar oder eher für ergänzend?
Diese Lösungen sind aktuell ergänzend, werden zukünftig jedoch in immer mehr Bereichen unverzichtbar werden. Sie dürfen allerdings nicht dazu führen, dass die menschliche Verantwortung vernachlässigt wird.

René Böhmerle
Ausbildung: Infektionsprävention im Gesundheitswesen (HFP) mit eidgenössischem Diplom, langjährige Erfahrung im Spitalbereich, insbesondere in Intensivmedizin/IMC und Anästhesie; Managementausbildung und Leitungsfunktion
Derzeit: B&B Hygieneberatung
Expertennetzwerk: hygieneforum.ch/hygiene-experten/
Erfahrungen aus der Praxis
Sie beraten viele Einrichtungen: Welche typischen Fehler oder Missverständnisse begegnen Ihnen immer wieder?
Da fällt mir als allererstes das Handschuhfiasko ein: Die weit verbreitete Annahme, dass das Tragen von Einweghandschuhen die Händehygiene ersetzt. Tatsächlich erhöht der falsche Gebrauch von Handschuhen ohne korrekte Händedesinfektion und ohne fachgerechten Wechsel das Kontaminationsrisiko enorm. Schwierig ist es auch, wenn z.B. Pflegeheime mangels hausinterner Ressourcen mit Hygienerichtlinien von Spitälern arbeiten, diese aber gar nicht auf das Risikoprofil der Institution passen. Oftmals findet man Material, das durch falsche Lagerung hygienisch nicht mehr einwandfrei ist. Auch die Trennung zwischen schmutzigen und sauberen Bereichen findet in den Arbeitsabläufen oft keine Beachtung, oder ist mit den räumlichen Gegebenheiten schwer umzusetzen. Ich könnte noch viele Punkte aufzählen. Vielleicht zum Schluss noch ein häufig anzutreffender Denkfehler. Die fast schon verzweifelte Fokussierung auf die Desinfektion aller Oberflächen, während die patientennahen, häufig berührten Oberflächen (High-Touch-Flächen) und Pflegehilfsmittel wie z.B. Duschstühle oft nicht sorgsam genug gereinigt und desinfiziert werden.
Gibt es Massnahmen, die sofort Wirkung zeigen und sich schnell umsetzen lassen?
Ich empfehle zu Beginn immer die Erfassung des Ist-Zustandes mittels eines Hygieneaudits. So können die vorhandenen Mängel identifiziert und entsprechende kurz- und langfristige Massnahmen geplant werden. Eine Massnahme, die relativ kurzfristig umgesetzt werden kann, aber eine enorme Verbesserung in der Händehygiene bringt, ist das Beheben der fehlenden Bereitstellung von Händedesinfektionsmittel am Point of Care. Kurzfristig umsetzbar sind auch Hygieneschulungen für alle Mitarbeitenden. Visuelle Handlungsanweisungen mittels Piktogramme wie z.B. das korrekte Beladen der Steckbeckenautomaten oder die korrekte Händedesinfektion lassen sich ebenfalls schnell anbringen. Um jedoch eine nachhaltige Wirkung zu erreichen braucht es einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der über einen längeren Zeitraum geplant werden muss.
Blick in die Zukunft
Wie wird sich die Infektionsprävention in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern?
Die Digitalisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz werden eine immer grössere Rolle einnehmen. Wünschenswert ist eine Zunahme von präventiven- und dadurch eine Abnahme von reaktiven Massnahmen. Es soll eine Kultur der Sicherheit entstehen mit einer tiefen Verankerung der Infektionsprävention als ein wichtiger Teil der Patientensicherheit auf allen Hierarchieebenen und bei allen beteiligten Fachgebieten. Damit dies erreicht werden kann, muss die Sensibilisierung für die Infektionsprävention bereits in der Ausbildung beginnen.
Welche Trends oder regulatorischen Entwicklungen sollten Einrichtungen im Auge behalten?
Primär sollte die Entwicklung in allen Bereichen der einzelnen Akteure beobachtet werden, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Was die regulatorischen Entwicklungen betrifft, sind hier die zwei Strategien des Bundes NOSO und StAR massgebend. Zudem werden nationale Qualitätsmessungen vermutlich auch in Alters- und Pflegeheimen verpflichtend. Dabei werden standardisierte Indikatoren zur Infektionsprävention wie z.B. die Rate von nosokomialen Infektionen, Händehygiene-Compliance oder den Verbrauch von Antibiotika gemessen und veröffentlicht. Ähnlich der strukturellen Mindestanforderungen für Spitäler, wird es zukünftig auch für Langzeitpflegeinstitutionen verbindliche Vorgaben geben, welche im Rahmen des Aktionsplans NOSO für Pflegeheime erarbeitet werden.
Ihre Botschaft & Persönliche Highlights
Wenn Sie eine zentrale Botschaft an Entscheidungsträger im Gesundheitswesen richten könnten: Was wäre Ihr wichtigster Appell?
Mein wichtigster Appell an Entscheidungsträger im Gesundheitswesen: There is no glory in prevention. Investieren Sie trotzdem in Hygiene! Nicht als Kostenfaktor, sondern als zentrale Säule der Patientensicherheit und der betrieblichen Exzellenz. Die Ressourcen für die Infektionsprävention – sowohl gut ausgebildetes Personal, als auch eine adäquate Infrastruktur – dürfen nicht dem kurzfristigen Spargedanken zum Opfer fallen. Ein einziger, grosser Ausbruch kann die Einsparungen von Jahren zunichtemachen. Prävention ist kosteneffektiver als die Behandlung von Infektionen. Die Verantwortung für eine wirksame Hygiene beginnt ganz oben im Management und muss als strategisches Führungsziel verankert werden.
Gibt es ein Projekt oder eine Initiative, die Sie unseren Lesern vorstellen möchten?
Ja, tatsächlich gibt es das. Aktuell bin ich am Aufbau eines Netzwerkes für Infektionsprävention in Pflegeheimen. Ganz nach den Vorstellungen des BAG versuche ich dies auf einer interkantonalen Ebene zu etablieren. Hier sollen alle Akteure wie Pflegeheime, Behörden und Verbände in einem Netzwerk verbunden sein, um so Ressourcen wie Wissen und Erfahrungen zu teilen und dadurch Zeit und Kosten für jeden einzelnen zu sparen.